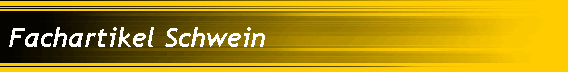
Erfolgsfaktor Fütterung: "dem Ferkel geben was es braucht"Dr. Heinrich Kleine KlausingEine phasengerechte, dem Verdauungsvermögen der Ferkel angepasste Fütterung, eine "verdauungsfreundliche" Futterstruktur und die gezielte Verwendung von Säuren sind grundlegend wichtige Faktoren zur Unterstützung des Stoffwechsels und der Widerstandskraft von Aufzuchtferkeln. Gerade unter den verschiedenen Virusinfektionen, die die Widerstandsfähigkeit der Tiere beeinträchtigen, ist die Kenntnis dieser Punkte wichtiger denn je. Wenn man sich über die Fütterung von Aufzuchtferkeln unterhält, ist man sehr schnell bei der Frage nach Möglichkeiten, den Tieren über die heute anzutreffenden Erkrankungen, die die Abwehrkräfte schwächen, hinweg zu helfen. "PMWS" ist nach wie vor in aller Munde - mit den Auswirkungen haben die Ferkel insbesondere im Darm zu kämpfen. In der Diskussion um die Unterstützung der Tiere muss die Frage gestellt werden, ob nicht so manche grundlegende und "einfache" Dinge der Ernährung in Vergessenheit geraten sind. Phasenfütterung an erster StelleDer wichtigste Erfolgsfaktor in der Fütterung ist die bedarfsgerechte Versorgung in jeder Aufzuchtphase. Das geht nur über eine Phasenfütterung mit einer leistungs - und gewichtsgerechten Futterzusammensetzung - Nährstoffe, Komponenten und Wirkstoffe müssen in einem Verhältnis zueinander stehen, das der Entwicklungsstufe der Ferkel angepasst ist. Mit einem einzigen Futter vom Absetzen bis zum Ende der Aufzucht ist diese wichtige Forderung nicht zu erfüllen. Hier geht kein Weg an mehreren, gezielt zu gestaltenden Phasen mit einem spezialisierten Prestarter, einem Aufzuchtstarter und einem sich anschließenden Aufzuchtfutter vorbei. Die Ferkel müssen in der entscheidenden Aufzuchtphase durch die Entwicklung des Enzymsystems die Grundlage für ihr Wachstum schaffen. Dabei ist zu beachten, dass die Aktivität wichtiger Verdauungsenzyme direkt nach dem Absetzen zurückgeht und erst sieben bis zehn Tage später wieder signifikant angestiegen ist. Dies ist bei der Wahl der Nährstoffquellen im Pre- und Aufzuchtstarter zu berücksichtigen. So gehört unter anderem sowohl in den Aufzuchtstarter für die ersten zwei bis drei Wochen nach Absetzen als auch in das Aufzuchtfutter aufgeschlossenes Getreide. Damit wird bei begrenzter Amylaseproduktion die Stärkeverdauung gezielt unterstützt und eine zu hohe Anflutung unverdauter Stärke im hinteren Dünndarmdrittel verhindert. Dies ist eine wirkungsvolle Durchfallvorbeuge. Das Starterfutter für die ersten zwei bis drei Wochen nach dem Absetzen sollte außerdem gezielt mit hochverdaulichen pflanzlichen Proteinkonzentraten (Sojaproteinkonzentrat, Kartoffeleiweiß) und Milchprodukten ergänzt werden.
Gerade der Futteraufnahme ist besondere Beachtung zu schenken. Mangelnde Aufnahme bzw. deutliche Schwankungen von Tag zu Tag in den ersten zehn bis 14 Tagen nach dem Absetzen sind häufig Wegbereiter für Verdauungsprobleme - soll heißen: Durchfall und in deren Folge Minderleistungen. Neben der Wasserversorgung kann auch die Fütterungstechnik in dieser Phase Einfluss auf die Futteraufnahme nehmen. Praxiserfahrungen und wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass ein feuchtkrümelig angebotenes Futter von den Ferkeln direkt nach dem Absetzen besonders gut angenommen wird und die Tageszunahmen dementsprechend höher sind. Dabei muss aber auf eine hohe Futterhygiene geachtet werden. Denn neben potentiellen Schadkeimen entwickeln sich sehr schnell Hefen, die sich auf Futteraufnahme und Gesundheit der Ferkel negativ auswirken können. Daher setzen sich in der Praxis immer mehr spezielle Anfütterungsautomaten durch, in denen das Futter mit Wasser vermengt und in kurzen Abständen gefüttert wird. Gerade für Ferkel, die sich mit PMWS-Symptomen auseinandersetzen, ist auch die Frage der Futterstruktur näher zu betrachten. Ein gut strukturiertes Mehlfutter ("griffige" Struktur) hat bei den heute üblichen ad-libitum-Fütterungstechniken häufig Vorteile. Die Ferkel nehmen das Futter gleichmäßiger auf, die Gefahr des "Überfressens" ist verringert. Das Futter wird gut eingespeichelt und im Magen entsprechend gleichmäßig durchsäuert. Damit werden pH-Wert-Schwankungen beim Übergang vom Magen zum Dünndarm verringert. Dies kann im Grenzbereich unspezifische Durchfallerscheinungen verringern und fördert insgesamt die Verdauungsstabilität. Ein entsprechend gut durchsäuertes Futter wird aber im Darm auch besser emulgiert - ein gerade unter PMWS wichtiger Faktor. Denn Leberstoffwechsel und der -kreislauf sind unter Infektionen, die die Immunabwehr schwächen, besonderer Belastung ausgesetzt. Die Ausschüttung der Gallensäuren, die bei der Verdauung der Nahrungsfette eine wichtige Funktion haben, ist dann oftmals gestört. Das kann sich bei einzelnen Ferkeln in breiigem Kotabsatz äußern. Bei der Gewichtsentwicklung stellt man in diesen Absetzgruppen ein deutliches Auseinanderwachsen fest.
Die Fettverdauung und der Leberstoffwechsel sollten über die Fütterung nicht zusätzlich belastet werden und der Rohfettgehalt im Aufzuchtfutter ist daher auf etwa 35 g je kg zu begrenzen. Das bedingt dann einen Energiegehalt von etwa 13,6 MJ ME je kg. Außerdem ist zu beachten, dass Ferkel, die sich mit viralen oder bakteriellen Infektionen auseinandersetzen, einen besonders hohen Bedarf an Aminosäuren haben. Die unspezifische Infektabwehr wird nämlich über die Makrophagen besonders beansprucht. Daher sollte im Aufzuchtfutter mindestens 0,9 g Lysin je MJ ME enthalten sein.
Verschiedene Schweinefachtierärzte begrüßen in gesundheitlich labilen Aufzuchtbeständen ein gut strukturiertes, mehlförmiges Ferkelfutter besonders dann, wenn Arzneimittel auf diesem Wege verabreicht werden müssen. Die Wirkstoffe der Medikamente sind bei der Futterherstellung keinen Stresswirkungen ausgesetzt. Die Verteilung des Arzneimittels im Darm ist bei einem gut emulgierten Futter ebenfalls verbessert und unterstützt so dessen Wirksamkeit.
Bevor man die Verwendung von Säuren in der Ferkelfütterung betrachtet, sollte man zunächst die Frage nach dem Grad der "Säurebindung" durch das Ferkelfutter näher püfen. Bereits in den 90er Jahren wurde die Bedeutung einer Begrenzung der sogenannten "Säurebindungskapazität" (SBK) auf unter 700 mmol HCl je kg Futter (wichtig: bestimmt auf Basis pH 3) für die "Sicherheit" eines Ferkelfutters herausgestellt.
In diesen Untersuchungen zeigte sich, dass in den Betrieben, die Ferkelfutter mit entsprechend niedrigem SBK in der kritischen Absetzphase verwendeten, die Durchfallhäufigkeit um den Faktor 2 bis 3 niedriger lag als in vergleichbaren Beständen mit einem SBK von 800 und mehr mmol HCl je kg Ferkelfutter.
Eine Begrenzung der SBK auf unter 700 mmol HCl je kg Futter ist durch verschiedene Maßnahmen möglich. Dazu gehört zum einen eine Begrenzung der besonders deutlich puffernden mineralischen Calciumquellen im Futter. Hierzu wird auf der einen Seite der Calcium- und parallel auch der Phosphorgehalt unter Zulage des Enzyms Phytase auf unter 0,85 % im Futter begrenzt. Gleichzeitig bietet sich die Verwendung "alternativer" Calciumquellen wie z. B. Calciumformiat ("Calciumsalz" der Ameisensäure) an. Auch erhöhte Rohproteingehalte im Futter wirken zusätzlich puffernd. Hier ist eine Begrenzung auf max. 18 % anzustreben. Da aber gleichzeitig eine hohe Aminosäurenkonzentration im Futter sicher zu stellen ist, müssen gerade im Absetzfutter nicht nur Lysin und Methionin, sondern auch nachfolgende limitierende Aminosäuren wie Threonin synthetisch zugesetzt werden. Auch der Einsatz von Säure hat Einfluss auf die SBK im Futter. Hier sind vor allem die sich im Magen auflösenden Säuren wie Ameisensäure und Phosphorsäure zu nennen. Die Effektivität dieser genannten Maßnahmen auf Leistungsparameter in der Aufzucht wurde auch in dänischen Untersuchungen aus dem Jahre 1999 belegt. Allein die Zulage von unter anderem 0,45 % Ameisensäure zu einem üblichen Ferkelfutter mit 0,86 % Calcium und 0,72 % Phosphor brachte 9 % bessere Tageszunahmen. In einer weiteren Parallelgruppe wurde unter Zulage von Phytase der Calciumgehalt auf 0,76 % und der Phosphorgehalt auf 0,60 % gesenkt. Hier verbesserte sich die Tageszunahme gegenüber der Kontrolle um 17 % und die Futterverwertung um 4 %. Dies sind deutliche Effekte. Aber Säure ist nicht gleich Säure. Hinsichtlich der Wirkmechanismen muss man zwischen den anorganischen Säuren (z.B. Phosphorsäure) und den organischen Säuren (z.B. Ameisensäure, Fumarsäure, Zitronensäure) unterscheiden. Die anorganischen Säuren haben ausschließlich einen Effekt auf den pH-Wert. Die organischen Säuren besitzen außerdem über das Anion einen hemmenden Effekt auf potentielle Schadkeime. Im Futter hat die pH-Wert-Reduzierung eine antimikrobielle Wirkung, was vor allem der Lagerstabilität des Futters zugute kommt. Im Magen wird über die pH-Wert-Regulierung die Mikroflora beeinflusst und das Pepsin für die Proteinverdauung optimal aktiviert. Im vorderen Dünndarm zeigt auf der einen Seite die leichte Ansäuerung positiven Effekt auf die Verdauung. Auf der anderen Seite geht das Anion komplexe Bindungen mit kationischen Mengen- und Spurenelementen (z.B. Ca, Cu, Mg, Zn, Fe) ein und verbessert so deren Verdaulichkeit. Außerdem hat das Anion, bzw. wenn noch nicht aufgelöst auch das vollständige Säuremolekül, einen regulierenden Einfluss auf die Zusammensetzung der Mikroflora im Darm. Die bereits genannten Salze der Säuren haben keine direkte pH-Wirkung. Sie stellen aber hochverdauliche Calciumquellen dar und auch die hemmende Wirkung des Anion auf mögliche Schadkeime ist weiterhin vorhanden. Diese vielschichtigen Effekte auf die Futter- und Fütterungshygiene sowie die Verdauung machen Säuren zu grundlegend wichtigen Sicherheitsfaktoren im Ferkelfutter. In den vergangenen Jahren sind die sogenannten "geschützten Säuren" neu auf den Markt gekommen. Die Säuremoleküle sind bei diesen Produkten in einer Fettkapselung eingebettet, worüber deren Auflösung im Magen-Darm-Trakt zeitlich gesteuert wird. Die Einflussgrößen "pH-Wert-Regulierung" und "Anionenwirkung" können so noch gezielter stabilisierend auf das natürliche Keimmilieu wirken.
Mai 2003
|
