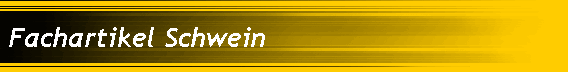
Verdauung und Darmgesundheit beim Schwein unterstützen |
 |
Ferkel mit einer sehr guten Kolostrumversorgung (Quantität und Qualität) hatten selbst nach 40 Lebenstagen noch eine deutlich höhere Konzentration an Immunglobulinen im Blut als Ferkel mit durchschnittlicher oder schlechter Versorgung. Und hier besteht laut den Untersuchungen ein enger Zusammenhang mit der Häufigkeit und dem Schweregrad von PMWS-Symptomen nach dem Absetzen. In schlecht mit Kolostralmilch versorgten Würfen können nach dem Absetzen Verluste von bis zu 80 % auftreten, während in gut versorgten Würfen keine bis niedrige Verluste festgestellt werden. Das sind Beobachtungen, die sich auch mit Erfahrungen in Deutschland decken. Die Häufigkeit von PMWS-Symptomen und damit verbundene Verluste streuen zwischen einzelnen Würfen deutlich. Die britischen Fachleute leiten aus ihren Untersuchungen ab, dass Ferkel mit einer Konzentration an Immunglobulinen unter 40 mg je ml Blut (mit "PMWS" gekennzeichnete Linie in der Graphik) eher von allgemeinen Erkrankungen und PMWS-Symptomen betroffen sind. Es lohnt sich also, Qualität und Quantität des Kolostrums zu optimieren und dafür zu sorgen, dass jedes Ferkel die gleiche Chance erhält, ausreichend Kolostralmilch aufzunehmen. Neben den vorstehend aufgezeigten Effekten prebiotischer Oligosaccharide ist die Bedeutung eines speziellen "Geburtsfutters" ante und post partum für die Nährstoffversorgung der Sau herauszustellen. Hiermit besteht dann u.a. auch die Möglichkeit, die Sau weitergehend über z.B. gezielte Vitaminzulagen zu unterstützen. So berichten PINELLI-SAAVEDRA et al. (2001) aus ihren Versuchen bei einer Zulage von 200 mg Vitamin E je kg Sauenfutter ante und post partum u.a. von signifikant erhöhten Vitamin E-Konzentrationen im Kolostrum am Tag der Geburt. Untersuchungen der Sauenmilch, des Blutserums und Lebergewebes der Saugferkel am 21. Säugetag ergaben ebenfalls signifikant höhere Vitamin E-Gehalte im Vergleich zur Kontrolle (30 mg Vitamin E je kg Futter).
Alle dargestellten Maßnahmen in der Ernährung der Sau zielen letztendlich auf die bestmögliche Unterstützung der Ferkel für einen möglichst guten Start nach dem Absetzen.
.... und dann ist das Ferkel auf sich gestellt .....
Nach dem Absetzen von der Sau ändert sich die Ernährungslage der Ferkel massiv. Hier sind zunächst grundlegende und "einfache" Faktoren der Ernährung von Bedeutung, die leider oftmals nicht beachtet werden. Schnell wird die Frage nach "unterstützenden Pülverchen" gestellt, ohne die Schlüsselfaktoren eingehender zu betrachten.
Der wichtigste "Schlüsselfaktor" ist und bleibt die "verdauungsgerechte Ernährung", die nur durch eine gezielte Phasenfütterung, orientiert u.a. an der Aktivitätsentwicklung der verschiedenen Verdauungsenzyme, gewährleistet wird. Hier sei nur das Stichwort "aufgeschlossenes Getreide" genannt. Durch einen druckhydrothermischen Aufschluss der Getreidestärke (z.B. im Weizen) und entsprechende Anteile des so behandelten Getreides im Ferkelfutter kann die Stärkeverdauung nach dem Absetzen gezielt unterstützt werden. Das ist neben dem reinen Leistungseffekt auch wirksame "Durchfallvorbeuge", denn es kommt weniger unverdaute Stärke in den Dickdarm und steht somit den potentiellen Schadkeimen nicht mehr als Nahrung zur Verfügung.
.... "die Schweine kennen Liebig!"
Wer kennt Liebig nicht? Jeder weiß, dass das "Fass nach wie vor an der kürzesten Daube ausläuft". In der Fütterung der Ferkel und Mastschweine ist diese "kürzeste Daube" häufig die Aminosäurenversorgung zu einem bestimmten Aufzucht- oder Mastzeitpunkt. Auch hier geht kein Weg an einer entsprechenden Phasenfütterung vorbei. Die Empfehlungen der Wissenschaft zur Versorgung mit Aminosäuren sind vom DLG-Arbeitskreis "Futter und Fütterung" im Jahre 2002 neu zusammengestellt und publiziert worden. Die Daten für die Ferkel und Mastschweine werden jetzt erstmalig in Abhängigkeit vom zu erwartenden Leistungsniveau (Tageszunahme) angegeben und damit dem bei unterschiedlichem Zunahmeniveau variierenden Fleischansatz Rechnung getragen. Die Aminosäurenversorgung ist speziell in Mastbetrieben mit einem Zunahmeniveau Richtung 800 g je Tag und darüber hinaus zu prüfen. Denn "mangelhafte" Magerfleischanteile können fütterungsseitig zwei Ursachen haben: zu üppige Energieversorgung in der Endmast (das erkennt man am Speckmaß) und/oder unzureichende Aminosäurenversorgung in der Ferkelaufzucht und/oder ersten Masthälfte (hier gibt das Fleischmaß erste Hinweise). Gerade bei niedrigeren Einstallgewichten von im Mittel 25 kg (und dann werden auch Ferkel mit 23 kg und weniger in einer geschlossenen Gruppe mit aufgestallt) muss für eine Tageszunahme von etwa 800 g in der Mast zwischen 0,82 und 0,85 g Lysin je MJ ME im Futter enthalten sein. Das sind bei 13,4 MJ ME/kg annähernd 11,5 g Lysin je kg Futter plus die erstlimitierenden Nachfolgeaminosäuren im Optimalverhältnis. Die verschiedenen Einflussmöglichkeiten seitens der Fütterung auf den Magerfleischanteil sind in der Abbildung 2 dargestellt.
Die Frage der Aminosäurenversorgung hat auch unter einem weiteren Aspekt große Bedeutung: Ferkel und Vormastschweine, die sich mit viralen oder bakteriellen Infektionen auseinandersetzen, haben einen besonders hohen Bedarf an Aminosäuren, da die unspezifische Infektabwehr über die Makrophagen deutlich beansprucht wird. Auch dies muss über das passende Phasenfutter sichergestellt werden.
 |
..... Futterstruktur - wichtig?
Die Fütterungstechnik hat sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Wo früher schon aus technologischen Gründen in der Ferkelaufzucht pelletiertes Futter im Vorratsautomaten für eine gute Futteraufnahme und möglichst geringe Futterverluste zwingend war, bieten Rohrautomaten etc. heute auch für ein gut strukturiertes Mehlfutter beste technische Voraussetzungen. Das hat gerade in Beständen mit erhöhtem "Infektionsstress" bei den Aufzuchtferkeln eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Ein gut strukturiertes mehlförmiges Ferkelfutter wird in der ad libitum-Fütterung gleichmäßig über die Zeit verteilt aufgenommen, gut eingespeichelt und im Magen gut durchmischt und durchsäuert. Das ist ein wichtiger Faktor für einen möglichst stabilen pH-Wert beim Digesta-Übergang in das Duodenum, kann im Grenzbereich unspezifische Durchfallerscheinungen verringern und fördert insgesamt die Darmgesundheit. Ein entsprechend gut durchsäuertes Futter wird im Darm auch besser emulgiert - ein gerade unter PMWS wichtiger Faktor. Denn Leberstoffwechsel und der enterohepatische Kreislauf sind dabei besonderer Belastung ausgesetzt. Die Ausschüttung und anschließende Rückresorption der für die Emulgierung der Nahrungsfette wichtigen Gallensäuren ist oftmals gestört. Das kann sich bei einzelnen Ferkeln in breiigem, leicht glänzendem Kotabsatz äußern. Dies sind dann auch häufig die Ferkel, die in der Gewichtsentwicklung zurückbleiben.
Infektionsabwehr und Aminosäurenversorgung
Ferkel, die sich mit viralen oder bakteriellen Infektionen auseinandersetzen, haben einen besonders hohen Bedarf an Aminosäuren, da die unspezifische Infektabwehr über die Makrophagen besonders beansprucht wird. Dies muss über das Aufzuchtfutter sichergestellt werden (siehe auch Tabelle 1). Das Futter muss insgesamt eine möglichst hohe Verdaulichkeit aufweisen. Daher gehört auch ins Aufzuchtfutter aufgeschlossenes Getreide.
Praxisbericht
Und wenn man diese Fütterungsempfehlungen beachtet, werden dann entsprechend positive Effekte festgestellt? Dazu folgender aktueller Praxisfall:
In der Ferkelaufzucht eines größeren Betriebes wurden die unter "PMWS" beschriebenen Symptome von Absetzgruppe zu Absetzgruppe in mehr oder weniger deutlicher Ausprägung festgestellt. Im Anschluss an einen Prestarter, der bei vierwöchiger Säugezeit bis drei/vier Tage über das Absetzen gefüttert wird, kommt über 14 Tage ein Aufzuchtstarter zum Einsatz. Dieses Futter erfüllt die phasenspezifischen Anforderungen an die Zusammensetzung und wird als strukturiertes Mehlfutter verabreicht. Im Anschluss an diese Phase wurde ein energiestärkeres pelletiertes Aufzuchtfutter eingesetzt. Etwa 25-30 % der Ferkel blieben ab der dritten Aufzuchtwoche in der Gewichtsentwicklung hinter den übrigen Ferkeln zurück und hatten zum einem großen Anteil eine breiige Kotkonsistenz. Die Futteraufnahme war suboptimal und die Ausstallgewichte lagen bei im Mittel 70 Lebenstagen knapp unter 25 kg. Im ersten Schritt wurde die Konzeption des Futters umgestellt - reduzierter Energie- und damit Fettgehalt, hohe Aminosäurenkonzentration und hohe Verdaulichkeit. Es war dadurch ein erster Fortschritt festzustellen - der Anteil Ferkel mit veränderter Kotkonsistenz verringerte sich, die Gleichmäßigkeit war begrenzt verbessert. Ein deutlicher Erfolg konnte festgestellt werden, nachdem Anfang Dezember 2002 auch das Aufzuchtfutter in griffiger Mehlstruktur eingesetzt wurde. Die vorstehend beschriebenen Symptome sind jetzt weitestgehend beseitigt und die Ausstallgewichte stabilisieren sich wieder bei 27 kg. Dieses Praxisbeispiel zeigt, dass oftmals das "Drehen an kleinen Schrauben" entscheidend ist und erst die gezielte Kombination verschiedener Managementfaktoren den angestrebten Erfolg bringt.
.... Wissen rund um Zusatzstoffe: Säuren
Die Verwendung von organischen und/oder anorganischen Säuren ist speziell im Ferkelfutter gängige Praxis. Aber warum werden die Säuren verwendet und warum gibt es verschiedene Säuren?
Bevor man sich mit den Säuren an sich beschäftigt, sollte man zunächst einen Blick auf das Ferkelfutter und die "Säurebindungskapazität" (SBK) des Futters werfen. Die SBK ist ein Maß für das Puffervermögen eines Futters. Es wird heute empfohlen, in einem Ferkelfutter unter 700 mmol HCl je kg Futter (Basis: pH 3) SBK zu liegen. Das ist über verschiedene Maßnahmen wie begrenzter Calciumgehalt (<0,85 %) bei gleichzeitigem Einsatz von Phytase, Verwendung "alternativer Calciumquellen" wie Calciumformiat, Begrenzung des Rohproteingehaltes auf 18 % unter Einsatz synthetischer Aminosäuren u.a. zu erreichen. Auch der Einsatz von Säuren, die überwiegend im Magen dissoziieren, wirkt reduzierend auf die SBK. Bei den wichtigsten Wirkmechanismen muss man zunächst zwischen den anorganischen Säuren (z.B. Phosphorsäure) und den organischen Säuren (z.B. Ameisensäure, Fumarsäure, Zitronensäure) unterscheiden. Die anorganischen Säuren haben ausschließlich einen pH-Wert-Effekt durch die Freisetzung der H+-Ionen (pH-Wert = negativer dekadischer Logarithmus der H+-Ionen-Konzentration). Die organischen Säuren besitzen außerdem über das Anion einen hemmenden Effekt auf potentielle Schadkeime. Im Futter hat die pH-Wert-Reduzierung eine antimikrobielle Wirkung, was vor allem der Lagerstabilität des Futters zugute kommt. Im Magen wird über die pH-Wert-Regulierung die Mikroflora beeinflusst und das Pepsin für die Proteinverdauung optimal aktiviert. Im vorderen Dünndarm zeigt auf der einen Seite die leichte Ansäuerung positiven Effekt auf die Verdauung. Auf der anderen Seite geht das Anion komplexe Bindungen mit kationischen Mengen- und Spurenelementen (z.B. Ca, Cu, Mg, Zn, Fe) ein und verbessert so deren Verdaulichkeit. Darüber hinaus wirkt das Anion bzw., wenn noch nicht dissoziiert, auch das vollständige Säuremolekül regulierend auf die Darmflora. Säuren haben damit vielschichtige Effekte auf die Futter- und Fütterungshygiene wie auch auf die Verdauung an sich und sind damit einer der bedeutendsten Sicherheitsfaktoren in der Ferkelfütterung. Die sogenannten "geschützten Säuren" stellen eine interessante Weiterentwicklung dar. Sie werden mit einer Fettkapselung versehen, worüber die Dissoziation der Säuremoleküle im Magen verringert wird. Dieser "Fettmantel" wird dann im Dünndarm enzymatisch gelöst und es erfolgt eine zeitlich verzögerte Freisetzung und Dissoziation der Säuremoleküle. Die Einflussgrößen "pH-Wert-Regulierung" und "Anionenwirkung" können so noch gezielter stabilisierend auf das natürliche Keimmilieu wirken.
.... Wissen rund um Zusatzstoffe: Probiotika & Co.
Probiotika gehören heute in ein die Darmgesundheit gezielt unterstützendes Ferkelfutter ebenso standardmäßig hinein. Sie übernehmen im Darm eine "Platzhalterfunktion" gegenüber potentiellen Schadkeimen wie z.B. Colibakterien und regen die Bildung sowie Ausschüttung körpereigener Enzyme an. Damit werden eine verbesserte Nährstoffverdauung, ein daraus resultierender Leistungseffekt und eine Reduzierung der "Nahrung für potentielle Schadkeime" im hinteren Dünndarm/vorderen Dickdarm erreicht.
Die vorstehend bereits genannten "Prebiotika" stellen auch in der Ferkelfütterung eine wirkungsvolle Unterstützung für die Darmgesundheit dar. Diese prebiotischen Oligosaccharide (Mehrfachzucker) können u.a. bei verschiedenen potentiellen Schadkeimen im Darm (z.B. E. coli) die Rezeptorstellen blockieren, so dass sich die Keime nicht mehr an die Darmwand anheften und ihre Toxine an die Darmzellen abgeben können.
.... Wissen rund um Zusatzstoffe: "Kräuter und Gewürze"
Die Gruppe der "Kräuter und Gewürze" - oder anders ausgedrückt: "phytogene Zusatzstoffe" - wird in den letzten Jahren immer wieder intensiv betrachtet und diskutiert. Futtermittelrechtlich werden solche phytogenen Zusatzstoffe der Anlage 3 Nr. 3 "Aroma und appetitanregende Stoffe" zugeordnet und sind demgemäss als Geschmacksverbesserer, die den Appetit anregen, in der Fütterung zu verwenden. Allen voran stehen hier Oreganoprodukte, Zimt, Thymian, Knoblauch und auch Anis im Mittelpunkt des Interesses. Einen umfassenden Überblick zur Wirkungsweise der verschiedenen Kräuter und Gewürze hat WESTENDARP (2001) zusammengestellt (Abbildung 3).
Neben dem reinen "Geschmackseffekt" bestimmter Produkte unterstützen z.B. natürliche Sanguinarine den Speichelfluss und die Magensaftsekretion. Das wiederum nimmt positiv Einfluss auf die Ausschüttung körpereigener Verdauungsenzyme und die Gallensäurebildung. Deren Bedeutung für die Verdauung - speziell die Fettverdauung -, den Leberstoffwechsel und die Aufrechterhaltung eines gesunden Darmmilieus wurde bereits eingehend dargestellt. Natürliche Saponine besitzen u.a. das Potential, die Schadgasbildung im Dickdarm zu regulieren und darüber z.B. positiv Einfluss auf die Ammoniakkonzentration in der Stallluft zu nehmen.
 |
Leistungseffekte sind versuchsseitig für verschiedene Produkte aus der Gruppe der Kräuter und Gewürze ermittelt worden und werden auch immer wieder aus der Praxis berichtet. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass die absolute Höhe des Effektes recht betriebsindividuell zu sein scheint. Produktkombinationen mit Sanguinarine und Saponine haben sich speziell in der Mast bewährt. Eine pauschale Einordnung der gesamten Gruppe "Kräuter und Gewürze" ist aber unter dem Aspekt der erforderlichen Kosten-Nutzen-Relation bisher nicht möglich.
.... Wissen rund um Zusatzstoffe: "Sondereffekte" durch Vitamine?
Der positive Einfluss von Vitaminzulagen im Futter, die über den eigentlichen Ernährungsbedarf deutlichst hinausgehen, sind insbesondere für Vitamin E, Vitamin C und die B-Vitamine bekannt. Bei Vitamin E kann an dieser Stelle u.a. auf die zu Beginn bereits dargestellten Ergebnisse von PINELLI-SAAVEDRA et al. (2001) hingewiesen werden. Aus der Praxis ist bekannt, dass eine Kombination aus u.a. verschiedenen B-Vitaminen, Folsäure und natürlichen Emulgatoren den Leberstoffwechsel positiv beeinflusst. Ferkel und Vormastschweine können darüber gerade bei PMWS-Symptomatik gezielt unterstützt werden. In diesem Zusammenhang können auch die Ergebnisse von COELHO (2001) sowie WEISS und QUANZ (2002) gesehen werden. In deren Versuchen wurden Mastschweine mit einer gegenüber den Versorgungsempfehlungen mehrfach erhöhten Konzentration an verschiedenen B-Vitaminen im Futter versorgt. Auf hohem Leistungsniveau (über 800 g Tageszunahme in der Kontrollgruppe) konnte in beiden Versuchen durch die erhöhte B-Vitaminversorgung Tageszunahme und Futterverwertung signifikant verbessert werden. COELHO (2001) führt die ermittelten Vorteile bei den Leistungsparametern u.a. auf eine gestärkte Immunantwort der Schweine zurück.
Fazit
Verdauung, Gesundheit und Immunantwort können über spezifische Maßnahmen in der Fütterung gezielt unterstützt werden. In der Kette "vom Saugferkel zum schlachtreifen Schwein" hat die Sau für die Gesundheit eine bedeutende Schlüsselposition. Die Qualität der Kolostralmilch nimmt auf die Widerstandskraft der Ferkel bis weit nach dem Absetzen Einfluss. In der Ferkelaufzucht sind für die "Darmgesundheit" zwei Faktoren wesentlich: zum Einen die bedarfs- (verdauungs-) gerechte Fütterung, deren Rahmenbedingungen in der Tabelle 1 zusammenfassend dargestellt sind, und zum Anderen die Regulierung des pH-Wertes im Magen-Darm-Trakt über Wahl der Futterzusammensetzung, Futterstruktur und Säuren.
 |
Literaturverzeichnis
Pig International April 2001, S. 31-34
KRÜGER, SCHRÖDL, SEIDLER, FRITSCHE (2000): Endotoxinassoziierte Erkrankungen landwirtschaftlicher Nutztiere unter besonderer Berücksichtigung des Schweines
Handbuch der tierischen Veredlung 2000, S. 251-264
Kamlage-Verlag, ISSN 0723-7383
O'QUINN, P.R., D.W. FUNDERBURKE, G.W. TIBBETTS (2001): Effects of diatery supplementation with oligosaccharides on sow and litter performance in commercial production systems
Journal of Animal Science 79 (2001) Suppl.1, S. 212
PINELLI-SAAVEDRA, SCAIFE, CELAYA, BIRNIE (2001): Transfer of vitamin E to piglet tissue, placenta, colostrum and milk from sows supplemented with vitamin E and vitamin C
Proceedings of the British Society of Animal Science 2001, S. 166
VARLEY, M. (2002): Colostrum quality reduces PMWS
Pig World 8 (2002), S. 46
WEISS und QUANZ (2002): Hat eine erhöhte Versorgung der Mastschweine mit B-Vitaminen einen Effekt auf Leistung und Wirtschaftlichkeit?
Fachinformation aktuell Nr. 12 vom 23.09.2002; Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz
WESTENDARP (2001): Kräuter in den Schweinetrog?
Landwirtschaftliches Wochenblatt Westfalen-Lippe Nr. 20, S. 30-32
März 2003